1.1 Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit
1.2Ausgangssituation und Aufgabenabgrenzung
2. Insolvenzen und Ihre Ursachen
2.1 Insolvenzen
2.2 Insolvenzursachen
3. Gründungsberatung - Insolvenzprophylaxe
3.1 Geschäftsgründungskonzeptes - Businessplan
3.2 Geschäftsidee
3.3 Produkt-, Markt-, Konkurrenzanalyse
3.3.1 Produktanalyse
3.3.2 Marktanalyse
3.3.3 Konkurrenzanalyse
3.4 Voraussetzungen zur Selbständigkeit
3.4.1 Persönliche Voraussetzungen
3.4.2 Fachliche Qualifikation
3.4.3 Kaufmanns Qualifikation
3.5 Rechtsform
3.6 Standortwahl
3.7 Finanzplanung
3.7.1 Kapitalbedarfsplanung
3.7.2 Finanzierung
3.7.3 Eigenkapital
3.7.4 Existenzförderprogramme
3.7.5 Fremdkapital
3.7.6 Umsatzplanung
3.7.7 Liquiditätsplanung
4. Entwicklung - Gründungen zu Insolvenzen
5. Resümee
2. Insolvenzen und ihre Ursachen
2.1 Insolvenzen
Mit einem Wachstum von 25,2% auf insgesamt 18800 waren die Insolvenzfälle in Deutschland im 1.Halbjahr 2002 zu registrieren.
In Westdeutschland waren es 13600 und in Ostdeutschland 5.200 Unternehmen, wie die nachstehende Grafik zeigt.
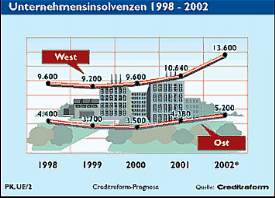
Im Gesamtjahr 2002 ist die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche gegenüber dem Vorjahr um 16,5 % auf 37700 Fälle angestiegen.
Insbesondere nahmen die Unternehmensinsolvenzen in Westdeutschland um 26600 Betriebe zu, das sind 22,3 % und in Ostdeutschland
lag die Steigerungsrate bei 4,3 % mit 1100 Betriebe.
2.2 Insolvenzursachen
Die Gründe für das hohe Insolvenzaufkommen ist nicht nur in der kon- junkturellen Schwächephase zu suchen.
Diese hat jedoch Auswirkungen auf die Unternehmen, die betriebswirtschaftlich und finanzwirtschaftlich ungenügend aufgestellt
und ausgestattet sind. Meist liegen die Ursachen unternehmensintern wie aus der nachstehenden Aufzählung zu entnehmen ist und nur in wenigen Fällen haben Insolvenzen externe Ursachen.
Insolvenzen bzw. Pleiteursachen von Unternehmen liegen i.d.R. bei
- - Finanzierungsmängel etwa 78 %
- Informationsdefizite etwa 60 %
- Qualifikationsdefizite etwa 50 %
- Planungsmängel etwa 30 %
- Überschätzung der Leistung des Unternehmers etwa 20 %
- Mängel bei der Betriebswirtschaftlichen Planung
Die unternehmensinterne Ursachen der Insolvenzen liegen zum grössten Teil in der Unternehmensfinanzierung.

